Auszug von Seiten 62-65
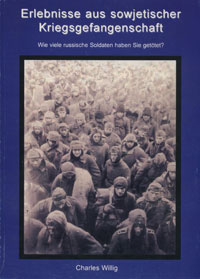 Der Winter 1944/1945 brach sehr früh ein; wir wurden noch vorher in ein anderes Gebäude, das als Hospital diente, verlegt. Es befand sich einige Kilometer weiter, war aber noch am Stadtrand von Tscherebowetze. Die Leitung dieses Hospitals oblag einem Militärarzt der Roten Armee im Rang eines Hauptmanns. Er war sehr streng, höflich und gerecht. Die Betreuung der Kranken und Verwundeten wurde von Ärztinnen der Roten Armee gewährleistet. Geplagt wurden wir wie fast überall in der Sowjetunion von den Wanzen, Läusen und Flöhen. Das Schicksal wollte es, dass eine Untersuchung aller Kranken und Verletzten stattfand, denn die Zahl der eingelieferten Kranken wurde immer größer. Das Hospital war überfüllt und bei dieser Untersuchung wurde ich unglücklicherweise für arbeitsfähig erklärt, weil meine Wunden an beiden Füssen seit einigen Tagen zugeheilt waren. Es war ein Tag Mitte November, ein wütender Schneesturm tobte übers Land. Mit noch anderen Gefangenen wurde ich von den Wachposten begleitet und vor das Gebäude an den Zaun hinausgeschickte, an dem schon einige Reihen Stacheldraht angebracht waren und den wir weiter mit noch mehr Reihen befestigen sollten, damit das Gebäude ringsherum mit Stacheldraht umzäunt war. Ich konnte es nicht einmal eine Viertelstunde lang in diesem Sturm und dieser Kälte aushalten. Die Wachposten hingegen eilten sofort ins Gebäude zurück, wo sie im Warmen saßen und uns dauernd beobachteten. Meine Füße schmerzten und ich hatte das Gefühl, als ob sie platzen wollten. Die kaum zugeheilten Wunden waren blau angelaufen und es bestand Gefahr, dass eine nochmalige Erfrierung eintreten könnte, was ich unbedingt verhindern musste. Allein der Gedanke an diese Tatsache gab mir die Kraft und den Mut, schreiend zurück ins Gebäude zu laufen, an den schimpfenden Wachposten vorbei, die mich zurückhalten wollten und mich aber trotzdem nicht daran hindern konnten. Ich stieg die Treppe hinauf, wo mir dann im Gang eine „Sestra" begegnete, die mich seit meiner Einlieferung in dieses Hospital gut kannte. Auf meine Füße deutend sagte ich gleich zu ihr: „Ya mnogo bolit, otschin plochoi" (Ich habe große Schmerzen, fühle mich sehr schlecht). Darauf sagte sie: „dawai, balata schesnazet" (Schnell auf Zimmer 16). Ich musste mich ausziehen und auf den Strohsack meiner Bettpritsche hinlegen. Die behandelnde Ärztin wurde gerufen. Sie sah die blau angelaufenen Füße an, die Sestra musste meine Füße mit Jod einpinseln und einen neuen Verband anlegen. Ich hatte diese Machtprobe überstanden und es war keine Gefahr mehr, dass mich jemand zur Arbeit zwang. Neben mir lag der aus Mulhouse-Dornach stammende Marcel Schmidt. Nach einigen Tagen kam ich in ein anderes Zimmer. Es war streng verboten, von einem Zimmer in das andere zu wandern, um nach Kameraden oder Freunden zu schauen. Es wurden immer Krankheitsübertragungen befürchtet. Zu dieser Zeit erfuhren wir durch die Zeitung „Freies Deutschland", dass die Amerikaner im Raum Aachen in schwere Kämpfe verwickelt wären und dass die Front sich dem Elsass nähere. Kälte und Schnee nahmen in diesen Novembertagen rasch zu. Die Arbeitskommandos, die draußen arbeiten mussten, kamen abends durchfroren und erschöpft zurück. Viele von ihnen wurden krank: Lungenentzündungen, Nierenentzündungen, angefrorene Glieder, Durchfall, Wassersucht, Hautkrankheiten usw. waren an der Tagesordnung. Es gab um diese Zeit fast jeden Tag Tote. Die Leichen wurden meistens vor dem Eingang dieses Hospitals außerhalb des Stacheldrahtzaunes in Massengruben verscharrt. Diese Gruben mussten natürlich von den Gefangenen selbst ausgehoben werden, manchmal sogar von jenen, die einige Tage oder Wochen später selbst dort ihre letzte Ruhe fanden. Man ließ die Leichen zuerst hart gefrieren und dann erst wurden sie hinausgetragen und in die Grube geworfen. Es kam vor, dass sich die Gefangenen auf die mit Leichen gefüllte Grube stellen und die Leichen zusammendrücken mussten, damit die Grube gut ausgefüllt wurde und keine Arme oder Beine herausragten. Wir waren jetzt mitten drin in der so gefürchteten Winterperiode, die sich hier im schon mehr nördlichen Russland sehr lange hinausschieben konnte. So mancher Gefangene wurde depressiv, traurig und lebensmüde. Der andauernde Hunger, zusehendes Abmagern, die hohe Todesrate, die zunehmenden Krankheiten aller Art, all das trug dazu bei, die beschissene Lage der Gefangenen noch zu verschlimmern und so manch einer verzweifelte. Der Winter 1944/1945 brach sehr früh ein; wir wurden noch vorher in ein anderes Gebäude, das als Hospital diente, verlegt. Es befand sich einige Kilometer weiter, war aber noch am Stadtrand von Tscherebowetze. Die Leitung dieses Hospitals oblag einem Militärarzt der Roten Armee im Rang eines Hauptmanns. Er war sehr streng, höflich und gerecht. Die Betreuung der Kranken und Verwundeten wurde von Ärztinnen der Roten Armee gewährleistet. Geplagt wurden wir wie fast überall in der Sowjetunion von den Wanzen, Läusen und Flöhen. Das Schicksal wollte es, dass eine Untersuchung aller Kranken und Verletzten stattfand, denn die Zahl der eingelieferten Kranken wurde immer größer. Das Hospital war überfüllt und bei dieser Untersuchung wurde ich unglücklicherweise für arbeitsfähig erklärt, weil meine Wunden an beiden Füssen seit einigen Tagen zugeheilt waren. Es war ein Tag Mitte November, ein wütender Schneesturm tobte übers Land. Mit noch anderen Gefangenen wurde ich von den Wachposten begleitet und vor das Gebäude an den Zaun hinausgeschickte, an dem schon einige Reihen Stacheldraht angebracht waren und den wir weiter mit noch mehr Reihen befestigen sollten, damit das Gebäude ringsherum mit Stacheldraht umzäunt war. Ich konnte es nicht einmal eine Viertelstunde lang in diesem Sturm und dieser Kälte aushalten. Die Wachposten hingegen eilten sofort ins Gebäude zurück, wo sie im Warmen saßen und uns dauernd beobachteten. Meine Füße schmerzten und ich hatte das Gefühl, als ob sie platzen wollten. Die kaum zugeheilten Wunden waren blau angelaufen und es bestand Gefahr, dass eine nochmalige Erfrierung eintreten könnte, was ich unbedingt verhindern musste. Allein der Gedanke an diese Tatsache gab mir die Kraft und den Mut, schreiend zurück ins Gebäude zu laufen, an den schimpfenden Wachposten vorbei, die mich zurückhalten wollten und mich aber trotzdem nicht daran hindern konnten. Ich stieg die Treppe hinauf, wo mir dann im Gang eine „Sestra" begegnete, die mich seit meiner Einlieferung in dieses Hospital gut kannte. Auf meine Füße deutend sagte ich gleich zu ihr: „Ya mnogo bolit, otschin plochoi" (Ich habe große Schmerzen, fühle mich sehr schlecht). Darauf sagte sie: „dawai, balata schesnazet" (Schnell auf Zimmer 16). Ich musste mich ausziehen und auf den Strohsack meiner Bettpritsche hinlegen. Die behandelnde Ärztin wurde gerufen. Sie sah die blau angelaufenen Füße an, die Sestra musste meine Füße mit Jod einpinseln und einen neuen Verband anlegen. Ich hatte diese Machtprobe überstanden und es war keine Gefahr mehr, dass mich jemand zur Arbeit zwang. Neben mir lag der aus Mulhouse-Dornach stammende Marcel Schmidt. Nach einigen Tagen kam ich in ein anderes Zimmer. Es war streng verboten, von einem Zimmer in das andere zu wandern, um nach Kameraden oder Freunden zu schauen. Es wurden immer Krankheitsübertragungen befürchtet. Zu dieser Zeit erfuhren wir durch die Zeitung „Freies Deutschland", dass die Amerikaner im Raum Aachen in schwere Kämpfe verwickelt wären und dass die Front sich dem Elsass nähere. Kälte und Schnee nahmen in diesen Novembertagen rasch zu. Die Arbeitskommandos, die draußen arbeiten mussten, kamen abends durchfroren und erschöpft zurück. Viele von ihnen wurden krank: Lungenentzündungen, Nierenentzündungen, angefrorene Glieder, Durchfall, Wassersucht, Hautkrankheiten usw. waren an der Tagesordnung. Es gab um diese Zeit fast jeden Tag Tote. Die Leichen wurden meistens vor dem Eingang dieses Hospitals außerhalb des Stacheldrahtzaunes in Massengruben verscharrt. Diese Gruben mussten natürlich von den Gefangenen selbst ausgehoben werden, manchmal sogar von jenen, die einige Tage oder Wochen später selbst dort ihre letzte Ruhe fanden. Man ließ die Leichen zuerst hart gefrieren und dann erst wurden sie hinausgetragen und in die Grube geworfen. Es kam vor, dass sich die Gefangenen auf die mit Leichen gefüllte Grube stellen und die Leichen zusammendrücken mussten, damit die Grube gut ausgefüllt wurde und keine Arme oder Beine herausragten. Wir waren jetzt mitten drin in der so gefürchteten Winterperiode, die sich hier im schon mehr nördlichen Russland sehr lange hinausschieben konnte. So mancher Gefangene wurde depressiv, traurig und lebensmüde. Der andauernde Hunger, zusehendes Abmagern, die hohe Todesrate, die zunehmenden Krankheiten aller Art, all das trug dazu bei, die beschissene Lage der Gefangenen noch zu verschlimmern und so manch einer verzweifelte.
Auszug von Seiten 85-89
Eine Woche später wurde ich von einem Wachposten aufgefordert: „Dawai Kommandantura". Ich beeilte mich und humpelte hinter dem Wachposten den Lagerweg zur Kommandantura. Die Baracke war mir inzwischen bekannt. Dort wurde ich in einen Raum gebeten, in dem mehrere Offiziere, ein Kommissar, darunter der Lagerkommandant und die schöne, blondhaarige Sekretärin saßen. Also wahrscheinlich war das gesamte NKWD-Büro anwesend. Ich musste auf einem Stuhl mit dem Rücken zur Wand Platz nehmen, damit alle Beteiligten im Raum mich sehr gut im Auge behielten. Die Sekretärin saß am Ende des Tisches mit direktem Blick auf alle Beteiligten. Nun sollte das große Spiel beginnen. Es war ja nicht das erste Mal, dass ich in der bisherigen Gefangenschaft einem Verhör ausgesetzt war. Der Lagerkommandant eröffnete dieses Verhör, indem er der NKWD-Sekretärin das Wort erteilte. Sie sagte mir, dass ich alle Fragen, die von den hier beteiligten Personen gestellt würden, direkt beantworten solle. Sie musste nun alle Fragen, die von den anwesenden Offizieren gestellt wurden, ins Deutsche übersetzen und ich musste darauf direkt Antwort geben. Die Antworten wurden dann ins Russische übersetzt. Aus früheren Verhören wusste ich, dass man sich in den Zahlen und Daten nicht irren durfte. Ich musste also auf der Hut sein und keinen Fehler bei diesen Angaben begehen. Die Aufsätze, die ich geschrieben hatte, konnte ich auswendig, so dass mir kaum ein Irrtum unterlaufen konnte. Nach etwa einer Stunde wurde eine fünfminütige Pause eingelegt. Dann begann ein wahres Kreuzverhör, bei dem mir mehrere Personen gleichzeitig Fragen stellten, die grundverschieden voneinander waren. Ich musste sehr aufpassen, um mir nicht zu widersprechen. Ich konzentrierte mich auf das Äußerste, um die Situation zu beherrschen. Die Dolmetscherin beherrschte die Lage vollkommen und ließ keine Frage aus. Sie musste auch vor allen Beteiligten meine Aufsätze Zeile um Zeile vorlesen. Ich kann heute nicht mehr sagen, wie lange dieses Spiel des Verhörens und des Ausfragens gedauert hat, aber ich sah es den Russen an den Gesichtern an, dass sie zufrieden zu sein schienen. Doch das Verhör war noch nicht zu Ende. Auf Geheiß des Lagerkommandanten musste die Dolmetscherin erneut beginnen mich auf Daten und Zahlen zu prüfen, indem sie an Hand meiner Niederschriften kreuz und quer durcheinander fragte, um festzustellen, ob meine mündlichen Aussagen mit den niedergeschriebenen Texten übereinstimmten. Als diese letzte Prozedur zu Ende war, machten alle Russen einen guten, zufrieden gestellten Eindruck. Einer der Offiziere gab mir eine Zigarette, dann fragten sie mich, natürlich immer über die Dolmetscherin, warum meine Wattejacke und die Hosen so schmutzig seien und ob die Arbeit, die ich verrichten muss, mir zusagt. Ich sagte, dass ich diese Klamotten in der Sauna (Entlausung) so bekommen habe und mit meiner jetzigen Arbeit zufrieden sei. Die Offiziere plauderten unter sich und ich wartete ab, was nun kommen würde. Nach einer Weile näherte sich mir die Sekretärin und sagte: „Nun hat sich alles geklärt, die Zweifel, die sich über die Nationalitäten-Frage gestellt hatten, waren nur ein Missverständnis. Doch unser Land erwartet von ihnen noch einen besonderen Dienst. Das werde ich ihnen gleich erklären, aber vorerst sollten sie wissen, dass, wenn sie es ablehnen sollten, uns den erwähnten Dienst zu leisten, wir immerhin in der Lage sind, ihnen während ihres Aufenthaltes hier in der Sowjetunion Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten zu bereiten, so dass es in ihrem Interesse liegt, guten Willen zu zeigen." Dann fuhr sie fort, indem sie sagte: „Ich werde ihnen jetzt einen Text vorlesen, den sie dann unterschreiben sollen. Sie sollen der Sowjet-Union in Zukunft alle Informationen und Auskünfte politischer und wissenschaftlicher Art zukommen lassen, aus dem Land in dem sie ihren Wohnsitz haben werden. Sie müssen einen Decknamen wählen, der ihr geheimes Kennzeichen sein wird. Zur gegebenen Zeit wird jemand Kontakt mit ihnen aufnehmen unter Benutzung des vorerwähnten Decknamens."
Die NKWD-Offiziere ließen mich nicht aus den Augen und starrten mich fortwährend mit durchdringenden Blicken an. Auf mir lag ein furchtbarer Druck und ich spürte, dass es keinen Ausweg mehr gab. Ich war sozusagen gezwungen, diesen Vorschlag anzunehmen, denn es blieb mir keine andere Wahl.
Den Wortlaut dieses Textes kann ich heute nicht mehr auswendig, doch er lautete ungefähr wie folgt:
„Ich Unterzeichneter, verpflichte mich der Sowjet-Union politische Informationen, Auskünfte und Mitteilungen aus dem Land, wo ich meinen Wohnsitz haben werde, zu erteilen. Die genannten Informationen werde ich der zuständigen Person, die mich zur gegebenen Zeit kontaktieren wird, übergeben. Ich verpflichte mich ausdrücklich, Niemanden von der Existenz dieser Abmachung in Kenntnis zu setzen weder hier in der Sowjet-Union noch in einem sonstigen Land oder Ort."
Datum: Unterschrift:
Als das alles beendet war, trat die hübsche Sekretärin erneut an mich heran und sagte: „Vergessen sie nicht, dass sie Niemandem hier im Lager oder sonst wo auf der Welt aussagen dürfen, was sich heute hier auf der Kommandantura zugetragen hat. Sie sollen auch wissen, dass unser Informationsdienst jeden Menschen auf der gesamten Erde erreichen kann, ganz gleich wo er sich befinden mag." Dann fügte sie noch hinzu: „Gut, nun können sie wieder auf ihre Baracke gehen. Wenn sie hier im Lager Schwierigkeiten wegen der Arbeit oder der Behandlung bekommen, so können sie zu jeder Zeit hierher zu mir auf die Kommandantura kommen." Ich kehrte nun wieder in meine Baracke zurück; obwohl ich über den Ausgang dieser Angelegenheit erleichtert war, so hatte ich doch ein unsicheres Gefühl über mein weiteres Schicksal.
Doch von diesem Tag ab und dann nach meiner Rückkehr in die Heimat wurde ich bis heute weder vom NKWD noch von einer sonstigen Organisation oder Person belästigt oder kontaktiert.
Lebenslauf von Charles Willig
 Charles Willig ist am 4. September 1921 in einem kleinen Dorf im Elsass (Voellerdingen) geboren. Dort ging er auch zur Volkschule bis 14 Jahren. Danach ging er zur Berufs-, Landwirtschafts- und Handelschule. Charles Willig ist am 4. September 1921 in einem kleinen Dorf im Elsass (Voellerdingen) geboren. Dort ging er auch zur Volkschule bis 14 Jahren. Danach ging er zur Berufs-, Landwirtschafts- und Handelschule.
Da das Elsass von 1940 bis 1945 an Deutschland angegliedert wurde, wurde Charles Willig ab 1942 ein Jahr in der Staatsverwaltung einberufen.
Im Januar 1943 wurde er zur Wehrmacht eingezogen und kam am 1. März 1944 in russische Gefangenschaft bis zur seiner Heimkehr Ende 1945.
Er wohnt mit seiner Familie in Wissembourg (Frankreich).
Sein Buch "Erlebnisse aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft" erschien 2005 im Helmesverlag Karlsruhe (ISBN: 3-9808762-3-3). |